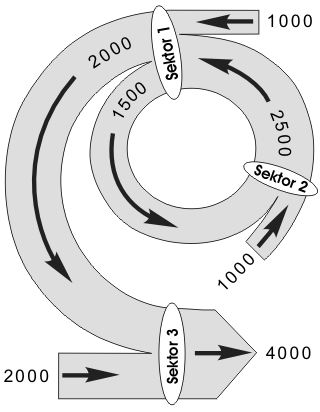| Autor: Paul Simek | |||
| keywords: #Investieren #Sparen #Kredit #Wachstum #Horten #Nachfragemangel | |||
|
Die Sparsamkeit ermöglicht eine hohe Akkumulationsrate und behindert gleichzeitig ihre Realisierung. Dieses paradoxe Wirken der kapitalistischen Spielregeln ist eine der Hauptfragen, die wir durch ökonomische Analysen aufzuhellen hoffen.
|
|||
| Joan Robinson, britische Ökonomin, scharfe Kritikerin der neoliberalen Gleichgewichtstheorie | |||
|
Die Originalität der mathematischen Wissenschaft liegt darin, dass in ihr Beziehungen zwischen Dingen zutage treten, die, bis die menschliche Vernunft eingreift, ganz uneinsichtig sind.
|
|||
| Alfred N. Whitehead, bekanter amerikanischer Philosoph und Mathematiker | |||
Wenn man Ökonomen über Zins sprechen hört, kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie sich über das Wirtschaftswachstum unterhalten. Heute wird in der Tat als selbstverständlich angenommen, dass der Zins mit dem Wirtschaftswachstum, also mit dem Sparen und Investieren sehr eng verbunden ist. Das ist einerseits nicht völlig falsch und andererseits ist dieser Zusammenhang für die Marktwirtschaft zweifellos sehr charakteristisch. Damit ist aber trotzdem nicht gesagt, dass es Zins nur dort gibt, wo es auch neue Investitionen gibt bzw. die Wirtschaft wächst. Zins und Wirtschaftswachstum sind nicht zwei Seiten ein und derselben Münze. Auch wenn die Wirtschaft auf eine unveränderte Weise immer weiter läuft – in der ökonomischen Theorie bezeichnet man das als stationär – kann es Zins geben. Wir haben uns diesen Fall in dem vorigen Aufsatz genauer angeschaut. Dort sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Zins mit Eigentumsverhältnissen bzw. mit dem Geldbesitz zu tun hat. Fassen wir das dort Gesagte kurz zusammen:
Wenn jemand Geld hat, muss er nicht willig oder nicht fähig sein zu wirtschaften, und jemand gern wirtschaften (unternehmen) würde, muss nicht unbedingt genug Geld zur Verfügung haben. Dann leiht der erste dem zweiten das Geld aus, d.h. gibt ihm Kredit, aber nicht umsonst: Der Kreditnehmer müsste dem ersten einen Teil des von ihm erwirtschafteten Gewinns überlassen. Diese Zahlung nennt man Zins. Was hat der Kreditnehmer oder Schuldner in den vorkapitalistischen Wirtschaften mit dem Kredit gemacht? Er war üblicherweise ein Landwirt, der von jemandem, meistens von einem in Not geratenen Landwirt, das Land abkaufte. So etwas ist auch heute noch in den ländlichen Gegenden gang und gäbe. Dass solche Kredite nichts mit dem Wachstum zu tun haben, liegt auf der Hand. Es haben sich nur Eigentumsverhältnisse geändert. Deshalb gab es Zins schon seit mehreren Jahrtausenden, in den Wirtschaften, die unvergleichbar weniger dynamisch waren als die kapitalistische, die genau genommen dermaßen stationär waren, dass man bei ihnen von einem Wachstum nicht einmal sprechen konnte.
Wir haben auch schon festgestellt, dass die Geldgeber in der Geschichte immer wussten, wie sie ihre Geldleihgeschäfte vor Risiko schützen können, nämlich durch juristisch absicherte Hypotheken, die sie dem Schuldner, wenn er in Not geraten ist, mit staatlicher Gewalt beschlagnahmen konnten. So konnten die Gläubiger im Prinzip nie verlieren, durch ihre Beteiligung am Gewinn bei den erfolgreichen Kreditnehmern, also durch Zins, gehörten sie immer zu den Gewinnern. Das kann zu sozialen Problemen führen, weil es zu einer Tendenz führt, dass die Reichen immer reicher werden. Der Staat kann dies aber durch sogenannte sekundäre Umverteilung verhindern, so dass es trotzdem nicht treffend wäre zu sagen, Kredit und Zins seien schon an sich etwas Gefährliches oder Böses. Auf das Maß und die Umstände kommt es an. So wie zum Beispiel ein Messer nicht an sich schuldig ist, wenn man mit ihm getötet hat. Auf jeden Fall ist die radikale Maßnahme, Kredite und Zins, oder Kredite mit Zins zu verbieten, ökonomisch sehr schädlich, was sich mit historischen Daten gut belegen lässt. Zins verhindert, dass das Geld von denen, die nicht wirtschaften wollen oder können, zu denen fließt, die es können und wollen.
Seit es den Kapitalismus gibt, wird immer wieder versucht, den Kredit bzw. den Zins – oder das Geld im Allgemeinen – für die zyklischen Krisen verantwortlich zu machen. Mit dem Josephspfennig wird dies auf eine anschauliche Weise dargestellt. Wie wir gezeigt haben, kann man dem Josephspfennig einen Unterhaltungswert nicht absprechen, einen wissenschaftlichen Erklärungswert hat er aber nicht. Solche Geschichten verhindern nur eine seriöse Diskussion darüber, warum die kapitalistische Marktwirtschaft seit ihrem Bestehen immer zyklisch zusammenbrach. Man findet dann die Schuld bei den Banken bzw. den „gierigen“ Bankern, was sehr gefährlich ist. Im nächsten Schritt verkuppelte man die Banker mit den Juden, und wohin das führte, ist gut bekannt. Die einfachen Lösungen sind immer einleuchtend, sie sind aber meistens falsch.
Wie gerade bemerkt, es kommt immer auf das Maß an. Ein Wissenschaftler ist derjenige, der versucht herauszufinden, welche Vorteile und Nachteile, welchen Nutzen und Schaden etwas bringt, konkret: Was bringt Kredit und Zins, bzw. das Geld überhaupt und unter welchen Umständen. Es gibt nichts was an sich gut oder böse ist, dass sollte man seit Hume und Kant wissen, es kommt auf die Umstände an. Ein System produziert böse Banker, nicht umgekehrt. In dem vorigen Aufsatz haben wir Zins unter den Umständen eines stationären Zustandes untersucht, jetzt ändern wir diese Annahme. Diese Annahme müssen wir ändern, weil für die Marktwirtschaft kaum etwas so charakteristisch ist wie das Wachstum. Wir stellen uns also die Frage: Ob Kredit und Zins in einer wachsenden Wirtschaft besondere Nachteile hätten oder gar großen Schaden verursachen würden. Wäre dies der Fall, dann sollte man sich Gedanken machen, wie sich das Wachstum ohne Kredite oder zumindest ohne Zinsen realisieren lassen könnte.
Wir werden gleich sehen, dass dies nicht der Fall ist. Auch beim Wachstum sind die Kredite und Zinsen keine Ursachen dafür, dass die freie Marktwirtschaft, wie wir es seit ihrem Entstehen kennen, immer wieder zyklisch zusammenbricht. Um den Kredit und den Zins von diesem Vorwurf freizusprechen, schauen wir uns jetzt das Wachstum näher an.
Der stationäre Zustand der Wirtschaft als Ausgangspunkt unserer Wachstumsanalyse
Sollte der Zins beim Wachstum Probleme verursachen, dann könnte dies nur an seiner Höhe liegen, die dann die Produktionskosten sehr belasten würde, so dass wir es offensichtlich mit einem quantitativen Problem zu tun haben. Deshalb muss sich unsere Untersuchung auf Zahlen und Zahlenregeln (Mathematik) stützen, weil sich die quantitativen Relationen mit Worten – mit dem binären Ja (1) und Nein (0) – gar nicht untersuchen lassen. Es muss aber nicht immer eine komplizierte Mathematik sein, sondern es reicht in vielen Fällen schon ein übersichtliches numerisches Beispiel. Ein solches Beispiel haben wir schon benutzt, an das wir jetzt anknüpfen. Es ist ein Beispiel, mit dem eine ganze Wirtschaft auf drei Sektoren und den Beziehungen zwischen ihnen reduziert wird. Um nicht zurückblättern zu müssen, wiederholen wir kurz das Wichtigste. Wir haben das Beispiel zusätzlich graphisch dargestellt, als ein Flussdiagramm, damit alles noch übersichtlicher und verständlicher wird.
Sektor 2 produziert Rohstoffe und Halbfabrikate, Sektor 1 Maschinen und Anlagen und Sektor 3 Konsumgüter. Die externen Inputs der Sektoren beinhalten verschiedene Leistungen bzw. dafür ausbezahlte Einkünfte (Löhne, Sondervergütungen, Profite, Dividenden, Grundrente, Zinsen, …), die in der Wirtschaft einerseits als Kosten und andererseits als Nettoeinkünfte fungieren. Diese Inputs stellen also die sog. Wertschöpfung dar.
Aus dem Flussdiagramm lässt sich unmittelbar entnehmen, dass alle Güterströme – gemessen in (absoluten) Geldpreisen – geschlossen sind. Dies betrifft jeden einzelnen Sektor, aber den Konsummarkt genauso: Die gesamte Nachfrage nach den Konsumgütern, also die Summe der externen Inputs oder Nettoeinkünfte aller Sektoren (1000+1000+2000) ist gleich dem gesamten Angebot an Konsumgütern, nämlich dem, was Sektor 3 als Output nach „draußen“ schickt (4000). Das wird in der Tabelle rechts noch einmal übersichtlich dargestellt. Man bezeichnet einen solchen Zustand auch als Gleichgewicht. Heben wir noch hervor, dass wir in unserem Fall ein stationäres Gleichgewicht haben – die Wirtschaft wächst nämlich nicht.
Die Zahlen in unserem Modell beziehen sich auf einen Zeitabschnitt, man sagt auch Reproduktionsperiode. Wir können annehmen, dass eine Reproduktionsperiode ein Jahr dauert – eine andere zeitliche Einheit wäre aber im Prinzip genauso gut. Während dieser Reproduktionsperiode produzieren die Sektoren Güter. In der folgenden Tabelle ist die Produktion jedes Sektors als Summe der Produktionskosten übersichtlich dargestellt. Alle Zahlen dieser Tabelle sind natürlich aus dem Flussdiagramm entnommen, was eigentlich offensichtlich ist.
|
Mit K sind Produktionsgüter dargestellt – man sagt auch reales Kapital -, die die Sektoren während der Produktion verbrauchen (und verschleißen), mit Ÿ die Wertschöpfung. Die letzte Spalte (Y) stellt den Preiswert der gesamten Produktion des jeweiligen Sektors dar. Ohne die Wertschöpfung hätte die Produktion keinen Sinn gehabt. Die Produktion soll nämlich mehr Güter herstellen, als sie verbraucht hat. Sie ist ein System mit Überschuss (produit net) wie es die Kreislauftheoretiker sagen. Wenn man den Unterschied zwischen neu hergestellten und verbrauchten Gütern preislich ausdrückt, bekommt man den numerischen Wert für die Wertschöpfung. Dieser Wert beträgt für die ganze Wirtschaft 4000.
Wir haben in der vorigen Tabelle die Wertschöpfung noch zusätzlich auf Löhne und Gewinne aufgeteilt. Als Beispiel haben wir angenommen, dass diese Anteile gleich sind, was einer Lohnquote von 50% entspricht, die – nebenbei bemerkt – etwa der Erfahrung entspricht. Die Lohnquote wird normalerweise für die ganze Wirtschaft ausgerechnet. Dieser Wert ist natürlich nicht bei allen Unternehmern gleich, wie wir es angenommen haben – sie hängt von vielen Faktoren ab -, aber diese sektoralen Unterschiede brauchen uns in unserem Fall nicht zu interessieren. Was den Gewinn betrifft, kann man ganz allgemein sagen, dass ihn immer der Kapitalbesitzer bekommt – der Eigentümer. Ist der Eigentümer zugleich Unternehmer, dann haben wir sozusagen den klassischen Kapitalisten in der Produktion, der den Profit bezieht. Kümmern sich um das Geschäft Manager, die mit fremdem Kapital bzw. Geld wirtschaften, dann muss aus dem Gewinn noch Zins bezahlt werden.
Wir haben auch noch eine Tabelle benutzt, in der wir den Tausch dargestellt haben: die Tauschtabelle. Auch diese werden wir gut gebrauchen, um den Wachstumsprozess zu verdeutlichen und zu verstehen. Wir werden es aber dabei nicht nötig haben, Löhne und Gewinne separat zu betrachten, so dass wir in den folgenden Tauschtabellen – nach wie vor – die Wertschöpfung zusammenfassen werden. Die nächste Tauschtabelle, die wir schon einmal hatten, schildert den stationären Zustand, von dem wir ausgehen.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANGEBOT
|
|
|
NACHFRAGE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wie diese Tauschtabelle zustande kommt bzw. wie der Tausch im Detail vor sich geht, haben wir in einem der vorigen Artikel gesagt (mehr…). Die Tauschtabelle zeigt nur präziser das, was auch das vorige Bild ahnen lässt, dass nämlich bei einem stationären Fall die einzelnen Sektoren ihre ganze Produktion problemlos absetzen können und dass damit auch die ganze Wirtschaft weiterhin im Gleichgewicht bleibt. Jetzt wollen wir das Wachstum simulieren.
Zwei Möglichkeiten des ökonomischen Wachstums: (1) ohne und (2) mit Kredit und Zins
Die kreislauftheoretische Analyse, anders als die partikel-mechanische (das Modell des Allgemeinen Gleichgewichts) – etwas mehr dazu später – , berücksichtigt auch die technischen Bedingungen des Wirtschaftswachstums. Deshalb ist sie komplexer und weniger abstrakt als die partikel-mechanische neoliberale Analyse. Wenn man die technischen Bedingungen berücksichtigt, kommt man nach einem kurzen Nachdenken zum Schluss, dass das Wachstum (bei unveränderten Produktionsmethoden) gar nicht anders beginnen kann, als dass zuerst Sektor 2 investiert. Indem er dank der neuen Investitionen mehr produziert, kann im nächsten Schritt (Reproduktionsperiode) Sektor 1 seine Produktion erweitern und erst danach auch Sektor 3 – der Konsumgüterhersteller. Wir schauen uns den ersten Schritt genauer an, zuerst im Flussdiagramm. Ein wichtiger Nebeneffekt der zusätzlichen Investitionen (+120) beim Sektor 2 ist, dass in unserem Fall – als das Wachstum von dem stationären Zustand ausgeht – Sektor 3 desinvestieren muss (-120).
|
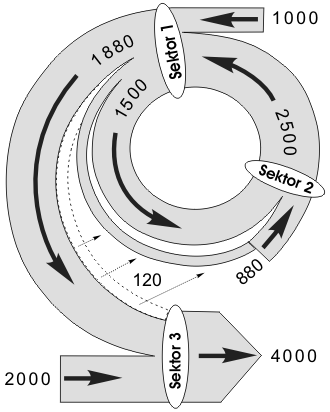 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das reale Kapital – die Produkte des Sektors 1 – kann sich also Sektor 2 nur besorgen, wenn er dieses Kapital den anderen wegnimmt. Dieser Sachverhalt ist rein technologisch bedingt und als solcher stellt er einen Sachzwang dar. Diese technische Problematik hat nichts mit der Frage zu tun: Woher nimmt Sektor 2 das Geld für seine Investitionen? Dies ist eine rein ökonomische Frage. Sie ist nicht besonders schwierig zu beantworten: Sektor 2 bzw. der Kapitalist kann einen Teil seines Gewinns – bei einer Lohnquote von 50% beträgt er 500 – für diesen Kauf verwenden. Dann wird er natürlich nicht soviele Konsumgüter – die Güter des Sektors 3 – kaufen können als bisher. Das nennt man Sparen. Fügen wir gleich noch hinzu, dass dieses Sparen zugleich zwei Bedeutungen hat. Das Sparen ist als Konsumverzicht etwas reales: Es wird real weniger konsumiert. Das Sparen ist ein monetäres Phänomen: Es wird nicht alles, was man als Nettoeinkommen verdient bzw. als Geld auf dem Konto hat, für Konsumgüter ausgegeben. Bemerken wir nur kurz, das es sich hier um zwei verschiedene Aspekte des Sparens handelt, die quantitativ ausgedrückt in keinem festen Zusammenhang stehen – aber dies nur nebenbei.
Der Fall, den wir gerade erörtert haben, zeigt, dass das Wachstum auch ohne Kredit und folglich auch ohne Zins möglich ist. Wir können diesen Fall als klassisch bezeichnen, weil wir da einen „klassischen“ Kapitalisten haben, der zugleich Unternehmer in seiner eigenen Fabrik ist und der genug verdient, aus seinem Gewinn bzw. Profit neue Investitionen zu finanzieren. Aber sogar der „klassische“ Kapitalist ist nicht gezwungen aus seinem eigenen Nettoeinkommen die Investitionen finanzieren. Er kann nämlich einen Kredit aufnehmen, den er natürlich zurückbezahlen müsste, mit dem Zins. Beides würde ihm gelingen, wenn er weiterhin „normale“ Gewinne erwirtschaften würde.
Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie das Wachstum in einer Wirtschaft durch das Sparen und Investieren realisiert werden kann:
| Das Wachstum ohne Kredit (und ohne Zins) | Das Wachstum mit Kredit und Zins |
| Dies wäre der Fall, wenn Sektor 2 dem „klassischen“ Kapitalisten gehören würde, der dann einen Teil (120) seines gesamten Gewinns (500) einsparen und investieren würde. | Dies wäre der Fall, wenn sich der „klassische“ Kapitalist verschulden wollte. Normalerweise ist dies der Fall bei den Firmen, die von den Managern verwaltet werden, die sich für ihre Investitionen das Geld ausleihen müssten. |
Heben wir noch hervor, dass sich das obige Flussdiagramm nicht ändern würde, unabhängig davon, ob man die Investitionen auf die eine oder andere Weise finanzieren würde – oder gemischt.
Zusammenfassung: Was Zins ist (und nicht ist) und was er verursacht (und nicht verursacht)
Es ist eine unbestrittene historische Tatsache, dass es Zins schon vor Jahrtausenden gab, als die Wirtschaften stationär waren. Wie wir es gesehen haben, bedeutete er schon damals nichts anderes als eine Trennung zwischen Eigentum und Unternehmertum. Den Zins kann es also auch in den nicht wachsenden Wirtschaften geben. Sogar in der kapitalistischen Marktwirtschaft kann es Wachstum auch ohne Zins geben – wie gerade erörtert. Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich mit Zins und Krediten die Investitionstätigkeit wesentlich verstärken und Wachstum beschleunigen lässt. Kann es aber auch unerwünschte Nebeneffekte geben? Ja, die gibt es überall, und überall dort, wo etwas vorhanden ist, was sich erschleichen lässt, kann sich auch kriminelle Energie entfalten, die großen Schaden verursacht. Dies wäre aber nicht die Folge davon, dass es Zinsen oder gar Kredite gibt. Es spricht aber manches dafür, dass sich die unerwünschten Nebenwirkungen des Zins- und Geldsystems in einem Rechtsstaat mit einer gut funktionierenden demokratischen Regierung auf ein verträgliches Maß minimieren lassen.
Da könnte man gleich entgegnen, dass wir gerade Zeugen sind, dass dies doch nicht stimmen kann, weil in den westlichen demokratischen Ländern die Banken und der Finanzsektor das Volk richtig ausgeplündert haben. Der Vorwurf stimmt aber insoweit nicht, weil wir in der letzten Zeit keine richtig demokratischen Staaten hatten, sondern neoliberale, die sich nicht um die Menschenwürde und die Interesse der Wähler kümmerten, sondern um die ökonomische Freiheit, um die Interessen der Reichen. Den gewaltigen Schaden, den uns das heutige Bank- und Finanzsystem verursacht hat, ist nicht durch Zins verursacht, sondern durch uneingeschränkte ökonomische Freiheit. Wie könnte nämlich ein Mensch den anderen ausrauben, wenn er nicht die Freiheit dazu hätte?
Zwei Arten wie der Nachfragemangel entstehen kann: der reale (1) und der monetäre (2)
Schon das letzte Flussdiagramm lässt ahnen, dass mit der Wirtschaft, nachdem sie zu wachsen begann, etwas nicht in Ordnung ist. Die dem System zur Verfügung stehenden Einkünfte – die Tabelle rechts schildert es zusätzlich – reichen für den Kauf aller bereits produzierten Konsumgütern auf einmal nicht mehr aus. Das Angebot ist kleiner als die Nachfrage. Es gibt eine Nachfragelücke (gap) von 120. Um dieses Ungleichgewicht besser zu verstehen, zeichnen wir uns eine Tauschtabelle anhand des obigen Flussdiagramms, und zwar nach dem gleichen Verfahren, das wir schon bei der ersten Tauschtabelle benutzt haben (mehr…).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANGEBOT
|
|
|
NACHFRAGE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Das gelbe Tabellenfeld zeigt, wie viel Konsumgüter der Sektor 3 nachfragen müsste, damit er seine ganze Produktion (Output) absetzen könnte. Es dann würde die Wirtschaft, nachdem sie zu wachsen beginnt, im Gleichgewicht bleiben. Vergleichen wir unsere zwei Tauschtabellen, stellen wir fest, dass Sektor 3 seinen Konsum von 2000 – im stationären Zustand – auf 2120 steigern muss. In der Praxis wäre dies aber aus mehreren Gründen so gut wie unmöglich. Das würde nämlich bedeuten, dass der Sektor einen Teil seines Kapitals „verkonsumiert“, und so etwas tun die Firmen nicht. So etwas können die Firmen möglicherweise gar nicht tun, und zwar wenn sie mit dem fremden Kapital wirtschaften. Mehr über diese Problematik steht in einem zusätzlichen Blogartikel. Dort wird der Wachstumsprozess weiter verfolgt, was wir hier – wo das Thema Zins ist – nicht mehr zu tun brauchen. (mehr…).
Erwähnen wir aber, dass schon J. C. L. Simonde de Sismondi (1773-1842), ein französischer Nationalökonom und Historiker, behauptet hat, dass das Einkommen fehlen kann und dadurch in der Wirtschaft ein Nachfrageproblem entsteht. Sismondi kann mit Recht als der Begründer der Nachfragetheorie bezeichnet sein. Er konnte das Problem leider nur wörtlich beschreiben, so dass er nicht überzeugend war. Sogar ein anderer damaliger Nachfragetheoretiker Thomas R. Malthus (1766-1834) fand seine Erklärung für den Nachfragemangel als nicht zutreffend. Er fragte provokativ, wie hätte die Wirtschaft je wachsen können, wenn durch eingespartes Nettoeinkommen immer eine Nachfragelücke auf dem Konsummarkt entstanden würde. Darauf hatte Sismondi keine passende Antwort. Aus dem, was wir gerade gesehen haben, würden wir Sismondi jedoch zustimmen. Aber er hatte trotzdem nicht Recht. Nicht jedes Sparen reißt eine Lücke zwischen der Nachfrage und dem Angebot. Das Problem mit der Nachfrage entsteht auch in unserem Fall erst am Anfang des Wachstumszyklus, später ist die Wirtschaft imstande, durch immer weitere Ersparnisse und Investitionen problemlos zu wachsen, also dass irgendwelche Nachfragelücken entstehen. In dem Aufsatz, zu dem wir vorhin gelinkt haben, lässt sich dies einfach simulieren.
Unterstreichen wir noch einmal, dass in unserem Fall die Nachfragelücke entstanden ist, weil die verfügbaren Einkünfte wirklich nicht ausgereicht haben, alle bereits hergestellten Güter zu kaufen. Es handelt sich in unserem Fall also nicht darum, dass jemand, der mit einem Einkommen verfügte, dieses nicht vollständig und unverzüglich ausgegeben hätte. In unserem Fall haben also alle Einkommensbezieher alles verbraucht. Einen solchen Nachfragemangel bezeichne ich als real, was in der ökonomischen Sprache das Gegenteil von monetär bedeutet. Es gibt aber auch ein monetäres Nachfrageproblem, monetär in dem Sinne, dass es mit dem Geld zu tun hat. Um diese ganz andere Art des Nachfragemangels zu verdeutlichen, knüpfen wir an das, was wir in dem Aufsatz Tausch und Tauschwerte bzw. Geld und wozu Geld und Banken gut sind gesagt haben:
Dort wurde geschildert, wie das Einkommen, das ursprünglich als Giralgeld existierte, zum Bargeld wird. Giralgeld und Bargeld sind uneingeschränkt konvertierbar. Wie man es kennt, kann sich jeder Einkommensbezieher praktisch immer seinen Kontostand in Bargeld auszahlen lassen und dieses Geld dann in seinem Garten begraben. In solchen Fällen verringern sich die Positionen auf der rechten Seite der Tauschtabelle, so dass ein Ungleichgewicht entsteht: Dem Angebot (links) steht nicht genug Nachfrage (rechts) gegenüber. Weil dieser Nachfragemangel mit Geld zu tun hat, bietet es sich an, ihn als monetär zu bezeichnen.
Unser „im Garten begraben“ ist natürlich eine Metapher. Sie ist eine überspitzte und ironische Bezeichnung dessen, was man fachmännisch als Horten bezeichnet. Aus dem bereits gesagten dürfte es ausreichend klar sein, dass das Horten etwas anderes als Sparen ist. Schon deshalb, weil das gehortete Geld keine Zinsen bringt. Aber ein anderer Unterschied ist noch wichtiger. Mit dem gehorteten Geld oder Einkommen wird nichts gekauft, mit dem gesparten schon, nämlich Produktionsgüter (reales Kapital).
Zum Horten lassen sich auch all die Fälle zuordnen, in denen das Einkommen durch irgendetwas mit Verspätung ausgegeben wird. Wenn sich dies summiert, kann sich schon eine beträchtliche Menge bilden – Kleinvieh macht bekanntlich auch Misthaufen. Einen auf solche Weise entstandenen Nachfragemangel kann man auch als keynesianisch bezeichnen. John M. Keynes (1883-1946) hat bekanntlich während der Großen Depression mit dieser Art von Nachfragemangel die Nachfragetheorie zum Sieg gebracht.
Der Nachfragemangel als die Frage des richtigen Denksystems oder Modells
Man hat sich schon viele Gedanken darüber gemacht, was mag damals geschehen sein, als Keynes mit der Nachfragetheorie siegte. Seine Theorie passte nämlich gar nicht zu dem damaligen Mainstream, zu der neoliberalen Angebots-Theorie, die seit drei Jahrzehnten wieder Mainstream ist. Die keynessche Nachfrage-Theorie war zweifellos ein radikaler Schnitt in der Entwicklung der ökonomischen Theorie. Einige Erkenntnistheoretiker haben bemerkt, dass es solche Einschnitte auch in den Naturwissenschaften gibt. Der amerikanische Erkenntnistheoretiker Thomas Kuhn hat sich da einen Namen gemacht. Er sprach von wissenschaftlichen Revolutionen und Paradigmenwechsel und hat dabei Folgendes gemeint:
Vor etwa einem Jahrhundert galt es für die Wissenschaftler als selbstverständlich, dass das neue Wissen aus dem schon vorhandenen hervorkommen würde. Dies bedeutete zugleich, dass die bereits etablierten Wissenschaften auf festen Grundlagen stünden, auf die man nur immer weiter aufbauen sollte. Aber die Zweifel, dass dies doch nicht stimmen könne, wurden immer stärker. Gerade bei der Königin der Wissenschaften, der Physik, häuften sich im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert die Zeichen, dass der eingeschlagene Weg nirgendwo mehr hinführte. Es gab damals zwei Möglichkeiten, wie man weiter vorgehen konnte. Die erste war, dass man es den Stückwerktechnikern überlässt, immer weiter sozusagen an allen Schrauben zu drehen. Wäre man dadurch erfolgreich, dann würde die Wirtschaft kumulativ, sozusagen evolutiv wachsen. Aber man war damit nicht erfolgreich. Die zweite Möglichkeit war, ganz neue analytische Grundlagen zu entwerfen. Erst dadurch schaffte die Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts den neuen Durchbruch. Der bekannteste Name aus dieser Zeit ist natürlich Einstein.
Es war Thomas Kuhn, der diese diskontinuierliche bzw. revolutionäre Fortentwicklung der Wissenschaften eingehend untersucht hat. Bei den „wissenschaftlichen Revolutionen“, so seine Schlussfolgerung, kommt es zum „Paradigmenwechsel“. Unter dem Paradigma verstand er ein in sich begrifflich und methodisch geschlossenes System der Wissenschaft, das die „Wissenschaftsgemeinde“ eine zeitlang für richtig hält. Das neue Paradigma bedeute aber nicht nur anders zu denken, sondern auch das Weltbild der Realität ändert sich nach einem Paradigmenwechsel vollständig. Kuhn schreibt:
„Unter der Führung eines neuen Paradigmas verwenden die Wissenschaftler neue Apparate und sehen sich nach neuen Dingen um. Und was noch wichtiger ist, während der Revolutionen sehen die Wissenschaftler neue und andere Dinge, wenn sie sich mit bekannten Apparaten an Stellen umsehen, die sie vorher schon einmal untersucht hatten. Es ist fast, als wäre die Fachgemeinschaft plötzlich auf einen anderen Planeten versetzt worden, wo vertraute Gegenstände in einem neuen Licht erscheinen und auch unbekannte sich hinzugesellen.“
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, S. 123.
Auch in der ökonomischen Theorie von Keynes sah die Welt auf einmal ganz anders aus. Was er getan hat, war zweifellos der Versuch eines Paradigmenwechsels. Aber der Sieg war nur von kurzer Dauer, und dies nicht nur, weil diese Theorie den Reichen und den Kapitalisten nicht ein bisschen gefiel – diplomatisch gesagt. Das Problem der keynesschen Nachfragetheorie ist, dass sich mit dem als monetär verstandenen Nachfragemangel wenig theoretisch anfangen ließ. Das bestätigt die Tatsache, dass die Nachfrage-Theorie nach dem frühen Tod von Keynes keine nennenswerte Weiterentwicklung erfuhr, und dies obwohl die Zahl seiner Anhänger, der Keynesianer, damals beträchtlich war. Es lässt sich zum Beispiel im Rahmen der keynesschen Theorie der zyklische Verlauf der freien Wirtschaft analytisch artikulieren, also erklären, woher die ökonomischen Krisen kommen. Mit dem real verstandenen Nachfragemangel, also im Rahmen des kreislauftheoretischen Modells ist die möglich (mehr…).
Die Theorie von Keynes war also doch kein analytisch richtiger Paradigmenwechsel. Sie war nur ein Turm auf den Grundlagen bzw. dem Gebäude der neoklassischen – einfacher gesagt neoliberalen – Theorie. Neben dieser theoretischen Schwäche hatte sie auch ein empirisches Problem: keiner konnte je das „begrabene Geld“ finden. Trotzdem bleibt Keynes unbestritten der beste Ökonom, den das 20. Jahrhundert hatte.
„Wie fehlerhaft auch immer die von Keynes erbrachte Analyse des Nachfragedefizites bzw. des Konjunkturzyklus sein mag, in einem irrte er nicht, nämlich daß dieses Nachfragedefizit tatsächlich bestand und immer wieder entsteht. Und weil er sich an diesen Befund mehr hielt als an seine eigene fehlerhafte Diagnose, irrte er auch nicht bei den Mitteln der Bekämpfung dieses Nachfragedefizites. Darauf aber kam es für die praktische Konjunkturpolitik in erster Linie an.
Keynes‘ praktische Vorschläge waren stets so gehalten, als ob er lückenlos bewiesen habe, daß ein Nachfragedefizit die Ursache allen Krisenübels sei, und weil dieses Nachfragedefizit in jeder Krise tatsächlich vorhanden ist, mußte seinen Vorschlägen … ein voller Erfolg zuteil werden. Die Wirkung dieses Erfolges wirkte nun ihrerseits wieder auf das Ansehen der Keynes’schen Theorie zurück und gab ihr einen Nimbus, der ihrer theoretischen Analyse in keiner Weise entsprach, den praktischen Ergebnissen seiner Krisenbekämpfungsmaßnahmen jedoch voll gerecht wurde.
Keynes vermochte zwar das Nachfragedefizit nicht aufzuhellen, aber sein Verdienst, diese Frage hartnäckig gestellt und in den Augen der Welt die Richtigkeit des Sayschen Theorems erschüttert, gleichzeitig aber eine gegen jede Wirtschaftskrise brauchbare Therapie entwickelt zu haben, bleibt auch für uns unbestritten.“
Gerhard Kroll, Von der Weltwirtschaftskrise zur Staatskonjunktur, S. 253-256.
Diejenigen, die sich weiter für den Paradigmenwechsel in der Wirtschaftswissenschaft interessieren, finden dazu hier mehr…
Die Geldschöpfung und der Nachfragemangel: Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Heben wir noch einmal hervor, dass Keynes nicht davon ausging, dass das Einkommen fehlen kann – da blieb er für immer ein Gefangener des Sayschen Gesetzes -, sondern er meinte, dass das bereits vorhandene Einkommen nicht vollständig und unverzüglich ausgegeben wird. So betrachtet würde die Wirtschaft immer über genug Geld verfügen, dieses würde sich nur irgendwo stauen, so dass die Aufgabe der Regierung darin bestünde, dieses Geld in die Wirtschaft zurückzuführen. Der Staat soll die unbeweglich gewordenen Einkünfte auf seine Schultern nehmen und sie zu den Gütern tragen. Konkreter gesagt: Ließen sich die Geldbesitzer – also die Wohlhabenden und Reichen – nicht dazu überreden, ihr Geld auszugeben, sollte der Staat sich von ihnen das Geld ausleihen und verbrauchen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, würde der Staat die Schulden zurückzahlen können. Die Praxis hat aber gezeigt, dass dies nicht besonders gut funktioniert, die Kreislaufanalyse erklärt warum: Die Nachfrage fehlt, vor allem, weil es nicht genug Einkommen bzw. Geld gibt. Das ist ein anderes Problem. Was tun?
Wenn das Einkommen bzw. das Geld fehlen kann, scheint die Lösung des Problems einfach zu sein: Man soll das zusätzliche Geld erschaffen („schöpfen“) und es der Wirtschaft zuführen. Schon Malthus hat sich darüber Gedanken gemacht, zu mutigen Schlussfolgerungen ist er doch nicht gelangt, was nicht wundern soll, wenn man bedenkt, dass man damals das gute Geld mit der Golddeckung gleichsetzte. Erst die Große Depression hat das Geld aus dem goldenen Käfig befreit. Heute hat sich das Geld schon weitgehend entmaterialisiert. Das wichtigste Geld ist das Buchgeld oder Giralgeld. Ein solches Geld lässt sich leicht und schnell vermehren. Da stellen sich vor allem die Fragen:
1: Wie viel Geld geschöpft werden soll
2: Wer soll dieses Geld schöpfen.
Die zweite Frage beantworten wir im nächsten Artikel. Die erste lassen wir uns für später, weil sie unvergleichbar komplizierter ist.